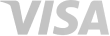Bruttoinlandsprodukt Ostasiens
Veröffentlicht: 3. Juni 2025Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) entspricht dem Gesamtwert der in Ostasien für den Endverbrauch bzw. -konsum hergestellten Güter und erbrachten Dienstleistungen, abzüglich aller Vorleistungen sowie Gütersubventionen und zuzüglich Gütersteuern. Zur geografischen Eingrenzung Ostasiens wird die Definition der Weltbank für die Region Ostasien-Pazifik herangezogen, allerdings unter Ausschluss Festlandchinas und Japans, deren BIP IBISWorld in separaten Einflussfaktoranalysen untersucht. Somit wird in dieser Analyse die wirtschaftliche Entwicklung der Volkswirtschaften von Australien, Brunei, Hongkong, Indonesien, Kambodscha, Kiribati, Laos, Macau, Malaysia, den Marshallinseln, Mikronesien, der Mongolei, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, den Philippinen, den Salomonen, Samoa, Singapur, Südkorea, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu und Vietnam betrachtet. Für die folgenden Gebiete liegen aus verschiedenen Gründen keine Wirtschaftsdaten vor: Amerikanisch-Samoa, Französisch-Polynesien, Guam, Myanmar, Neukaledonien, Nordkorea, Nördliche Marianen und Tuvalu.
Was in einer IBISWorld Mitgliedschaft enthalten ist
- Unsere Branchenreporte beinhalten mehr als 40 Seiten an Daten, Analysen und Grafiken, unter anderem zu:

Branchenkennzahlen
Historische und erwartete Wachstumsraten
Marktgröße
Hauptakteure
Gewinnanalyse
SWOT-Analyse
Trends
Operative Bedingungen
Aktuelle Trends – Bruttoinlandsprodukt Ostasiens
Seit 2020 ist das BIP Ostasiens durchschnittlich um 3,8 % pro Jahr gestiegen, sodass es 2025 einen Stand von 8,8 Billionen US-Dollar erreichen dürfte. Dies entspricht einem Anstieg um 2,6 % im Vergleich zum Vorjahreswert.
Die Wirtschaftsregion Ostasien setzt sich zum einen aus wenigen kleinen, hoch entwickelten Volkswirtschaften zusammen, die fast ausschließlich auf Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen basieren, und zum anderen aus Entwicklungsländern, deren Volkswirtschaften auf die Herstellung kostengünstiger Waren ausgerichtet sind. Die vollständig entwickelten Volkswirtschaften Südkoreas und Australiens dominieren die Gesamtwirtschaft Ostasiens, da sie etwa die Hälfte des BIP der Region generieren. Hongkong, Singapur und die Entwicklungsländer Indonesien, Malaysia, Philippinen und Thailand tragen jeweils mehr als 4 % zum BIP bei.
Ostasien verzeichnete in den Jahren vor der globalen Finanzkrise 2008 ein starkes Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft Südkoreas, Singapurs und Hongkongs boomte und auch die jeweiligen Finanzmärkte wuchsen rapide. Die australische Wirtschaft, die sowohl vom Finanzdienstleistungssektor als auch von Rohstoffexporten abhängig ist, profitierte von der weltweiten Verteuerung zahlreicher Rohstoffe Mitte der 2000er-Jahre. Unterdessen exportierten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in Südostasien zunehmend Waren nach China, Europa und in die USA, wo die Wirtschaft ebenfalls florierte. Diese Entwicklung fand jedoch Ende 2008/Anfang 2009 ein abruptes Ende, als die Finanzmärkte nach dem Platzen der US-Immobilienpreisblase weltweit einbrachen und der Welthandel zum Erliegen kam. Infolgedessen verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum Südkoreas und Hongkongs im Jahr 2009 deutlich, während Singapurs Wirtschaft durch den Kollaps der heimischen Finanzindustrie sogar schrumpfte. Der zeitgleiche Rückgang der Rohstoffpreise führte auch zu einer Stagnation der Wirtschaft Australiens. Wegen der Rezession oder Stagnation, mit der ihre wichtigsten Handelspartner China, USA und Europa konfrontiert waren, konnten die auf den Export ihrer Rohstoffe angewiesenen Entwicklungsländer ebenfalls kein Wirtschaftswachstum verzeichnen. Vielmehr mussten sie zum Teil Rückgänge hinnehmen.
Jedoch profitierten die exportorientierten Entwicklungsländer Südostasiens ab 2010 von der schnellen wirtschaftlichen Erholung Chinas, die sich dem milliardenschweren Konjunkturprogramm der chinesischen Regierung verdankte und die dortige Nachfrage nach Rohstoffen erhöhte. Dies kompensierte den Umstand, dass sich die beiden anderen wichtigen Handelspartner, die USA und Europa, nur langsam vom Abschwung der Jahre 2008 und 2009 erholten. Zugleich konnte Südkorea einen deutlichen BIP-Rückgang während der globalen Rezession vermeiden, da der Anstieg der Binnennachfrage die Verringerung der Auslandsnachfrage nach Informationstechnologie ausglich. Ab 2010 trug zudem die steigende Nachfrage Japans und der USA nach Informationstechnologie zur wirtschaftlichen Erholung Südkoreas bei. Singapur, Hongkong und Australien konnten durch die Stabilisierung der Finanzmärkte ebenfalls wieder ein Wachstum verbuchen, weshalb die Region Ostasien von 2010 bis 2014 insgesamt positive und stabile Wachstumsraten verzeichnete. Lediglich 2015 stieg das BIP etwas schwächer, was auf den Einbruch der Rohstoffpreise zurückzuführen war.
Seitdem hat sich das Wachstum zwar beschleunigt, konnte aber nicht an das Wachstum in den Jahren unmittelbar nach der globalen Rezession heranreichen. 2017 war ein besonders gutes Jahr für die Region, in dem das BIP-Wachstum das schnellste seit 2012 war. Dies deckt sich mit der Entwicklung eines Großteils der Weltwirtschaft, da 2017 weltweit ein höheres Wachstum zu verzeichnen war. 2018 profitierte die Region zudem von dem Inkrafttreten des Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), das unter anderem den Wegfall von Zöllen für Agrar- und Industrieprodukte bewirkte. Der davon ausgehende positive Effekt wurde lediglich durch den im selben Jahr erfolgten Ausstieg der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft abgeschwächt, durch den die Handelshemmnisse in Bezug auf den Export von Rohstoffen und Waren in diesen wichtigen Absatzmarkt weiterhin bestehen blieben.
Im Jahr 2020 schrumpfte das BIP der Region um 2,2 %, da pandemiebedingte Lockdowns die wirtschaftliche Aktivität erheblich einschränkten. Mit der allmählichen Erholung und Wiederöffnung der Wirtschaft im Jahr 2021 wuchs das BIP wieder um 4 %. Seither werfen jedoch zunehmende geopolitische Spannungen und Handelskonflikte Schatten auf die Weltwirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Preise für Nahrungsmittel und Energie.
Fünfjahresausblick – Bruttoinlandsprodukt Ostasiens
In den nächsten fünf Jahren wird das BIP Ostasiens im Dur...